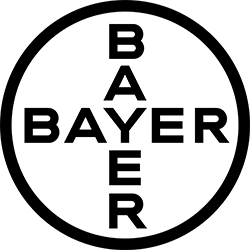Was uns in der Steinzeit vor dem Angriff des Säbelzahntigers gerettet hat, kann heutzutage der Auslöser von Depressionen sein. Denn ist der Kortisolspiegel beispielsweise durch chronische Überlastung und Stress dauerhaft erhöht, kann eine Dysregulation der physiologischen Stressantwort und schließlich auch eine Depression die Folge sein. Wir zeigen, warum das heute für die Behandlung von Depressionen eine Rolle spielen kann.
Lesedauer ca. 2,5 Minuten
Stress als ständiger Begleiter: Das sind die Folgen
Stress aktiviert die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse (engl. hypothalamus-pituitary-adrenocortical, kurz HPA-Achse), was schließlich zur Ausschüttung von Kortisol und in der Folge zu den in dieser Situation nötigen physiologischen Anpassungen führt. Ist der Stress akut – wie beim Angriff des Säbelzahntigers – wird eine sehr schnelle Flucht- oder Kampfreaktion gefordert. Danach bewirkt der erhöhte Kortisolspiegel normalerweise über eine negative Rückkoppelung eine schnelle Rückregulation der HPA-Achse. Geschieht dies nicht, weil durch chronischen Stress der Kortisolspiegel erhöht bleibt, kann es zu Störungen verschiedener Systeme wie Stoffwechsel, Herz-/ Kreislaufsystem oder Immunabwehr kommen.1 Ein eindrückliches Beispiel für die Folgen eines Hyperkortisolismus sind Patienten mit Cushing-Syndrom: Neben Übergewicht, Hypertonie und Überzuckerung leiden sie auch häufig an Depressionen.2
Physiologische Stressreaktion ist bei Depressionen gestört
Viele Depressionspatienten weisen während einer akuten Episode eine HPA-Hyperaktivität mit Hyperkortisolismus auf. Die gestörte Stressantwort normalisiert sich unter einer antidepressiven Behandlung jedoch bei den meisten wieder und die Remissionsrate dieser Patienten ist dann auch höher. Bleibt die Normalisierung aber aus, wird die Prognose hinsichtlich des weiteren Behandlungsverlaufs unter der aktuellen Therapie als ungünstig eingestuft.1,2
So lässt sich die Regulationsfähigkeit der HPA-Achse messen
Mit dem Dexamethason (DEX)/Corticotropin Releasing Hormone (CRH)-Test kann die Regulationsfähigkeit der HPA-Achse gemessen werden. Dexamethason wirkt dabei dämpfend, CRH stimulierend auf die HPA-Achse. Funktioniert die HPA-Achse normal, kommt es trotz CRH-Gabe zu einer Unterdrückung der Kortisolsekretion. Bei einer Fehlregulation kommt es unter CRH-Gabe hingegen zu einer deutlichen Kortisolstimulation. Bei Depressionen, insbesondere rezidivierenden Formen, wird häufig eine gestörte Regulation festgestellt. Sprechen Patienten auf die antidepressive Therapie an, scheint eine Normalisierung der Regulation dem Therapieerfolg vorauszugehen.1
Antidepressiva: Angriffspunkt auch an der Stressachse?
Eines der wesentlichen Therapieziele ist es, die bei chronischem Stress überaktive HPA-Achse zu normalisieren. Dies kann einerseits durch die Reduktion der Stresshormone Adrenocorticotropin (ACTH) und Kortisol erreicht werden. In einem Tiermodell für chronischen Stress konnte eine solche Reduzierung für Fluoxetin als auch für einen Johanniskrautextrakt (STW3-VI) gezeigt werden.3
Ein anderer wichtiger Angriffspunkt ist das FKBP5-Gen, dessen Expression die Empfindlichkeit des Glukortikoidrezeptors für Kortisol reduziert. Bei hoher Expression dieses Gens kommt es schlussendlich zu einer überschießenden Stressantwort und chronisch erhöhten Kortisolwerten.4,5 Dass Antidepressiva die Stressantwort auch über diesen Weg normalisieren können, bestätigen Daten, die eine Korrelation zwischen klinischem Therapieerfolg und reduzierter FKBP5-Expression unter antidepressiver Therapie zeigen.5 Zudem fand eine in vitro Untersuchung einer neuronalen Zelllinie eine Reduktion der FKBP5 Expression unter Inhaltsstoffen von Johanniskraut, die vergleichbar zur Wirkung von Citalopram war.4
Was macht Johanniskaut zum wirksamen Antidepressivum?
Neben seinem Einfluss auf die HPA-Achse interagiert Johanniskraut-Extrakt mit allen 3 für die emotionale Regulierung essenziellen Neurotransmittersystemen. Mehr zum Wirkprinzip von Johanniskraut finden Sie hier.
Sie möchten mehr über den aktuellen Forschungsstand erfahren?
Einen detaillierten Review der Wirkmechanismen von Johanniskrautextrakt können Sie hier kostenfrei herunterladen.
Langfristig nicht nur an Medikamente denken!
Neben der Akutbehandlung mit Antidepressiva, sind langfristig psychotherapeutische und körperorientierte Entspannungsverfahren Wege, die Stressachse über eine Reduktion des Sympathikus bzw. Aktivierung des Parasympathikus zu normalisieren. In Frage kommen beispielswiese progressive Muskelrelaxation, autogenes Training, Yoga, Qi-Gong, Tai-Chi, Biofeedback und Neurofeedback. Auch achtsamkeitsbasierte Psychotherapien können sich positiv auf die Stressachse auswirken.2
Quellen:
- Ising M. Stresshormonregulation und Depressionsrisiko – Perspektiven für die antidepressive Behandlung. Forschungsbericht 2011 – Max-Planck-Insitut für Psychiatrie.
- Krähenmann R et al. Krank durch chronischen Stress. DNP – Der Neurologe & Psychiater 2019;20(4):38-46.
- Grundmann O et al. Mechanism of St. John’s wort extract (STW3-VI) during chronic restraint stress is mediated by the interrelationship of the immune, oxidative defense, and neuroendocrine system. Neuropharmacology 2010; 58: 767-773.
- Dillenburger B et al. Aktueller Forschungsstand zum pflanzlichen Antidepressivum Johanniskrautextrakt. Aktueller Forschungsstand Nervenheilkunde 2020; 39:565-571.
- Ising M et al. FKBP5 Gene Expression Predicts Antidepressant Treatment Outcome in Depression. Int J Mol Sci 2019;20(3):485.
Bildquelle:
©istockphoto.com/jodo19
Weitere Beiträge
Sie benötigen medizinische Informationen zu diesem Produkt?
Wir sind für Sie da:
Mo-Fr: 8:00 - 18:00 Uhr
Tel.: 0800 6422937
E-mail: medical-information@bayer.com
Web: www.medinfo.bayer.de
Haben Sie Fragen rund um das vielfältige Service-Angebot von Bayer Vital?
Dann schreiben Sie uns einfach über unser Kontakformular.
Wir freuen uns auf Ihre Anmerkungen.