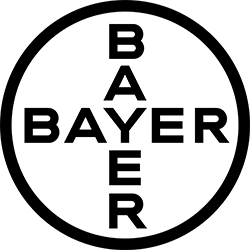Antidepressiva führen nicht immer zu einem klinischen Effekt. In einer neuen Studie aus Stanford wurden Erkrankte mit Depressionen in 6 Biotypen eingeteilt. Die Forschenden zogen Rückschlüsse auf das Ansprechen auf Antidepressiva bei diesen Biotypen.1 Doch eignet sich das Vorgehen für den Praxisalltag?
Trial & Error: Noch immer Standard in der Depressionsbehandlung?
Depressionen sind eine heterogene Erkrankung. In der Praxis zeigt sich kein homogenes Krankheitsbild, sondern ein Beschwerdebild, das patientenindividuell variieren kann. Nach heutigem Kenntnisstand liegt dem Syndrom Depressionen ein komplexes Zusammenspiel von Wechselwirkungen aus biologischen und psychosozialen Faktoren zugrunde, wobei die Relevanz der einzelnen Faktoren individuell stark variiert.2
Deshalb verwundert es nicht, dass die Ansprechraten einer Therapie mit Antidepressiva nicht vorhersehbar sind. In der Fachliteratur werden sie mit 50–70 % angegeben.3 Im Praxisalltag bedeutet dies mit Blick auf die medikamentöse Behandlung von Depressionen häufig: Trial & Error.
Doch mit dem Blick in die Glaskugel bei der Therapieauswahl soll nun laut Forschenden der Stanford University School of Medicine Schluss sein. In ihrer kürzlich in Nature Medicine veröffentlichten Studie ordnen sie Patientinnen und Patienten in 6 Biotypen der Depression ein. Die Einteilung soll eine Aussage darüber ermöglichen, ob die Erkrankten besser auf eine Psycho- oder Antidepressiva-Therapie ansprechen.1
MRT-Clusterung: Hirnaktivität bestimmt Ansprechen auf Antidepressiva
Die Einteilung in die 6 Biotypen der Depression basiert auf der Messung der Gehirnaktivität in frontalen und subkortikalen ZNS-Regionen mittels eines standardisierten funktionellen Magnetresonanztomographie (MRT)-Protokolls.1
In der Studie wurde die Gehirnaktivität in Ruhe und in Aktivität von 801 Patientinnen und Patienten gemessen, die entweder an Depression oder an Angststörungen litten. Darüber hinaus erfolgte eine Gehirnaktivitätsmessung per MRT bei137 gesunden Kontrollpersonen. Zu Studienbeginn (Zeitpunkt des Baseline-MRT-Scans) nahmen 95 % der Teilnehmenden keine antidepressive Behandlung ein. Substanzabhängige Störungen wurden ausgeschlossen.1
Anhand der MRT-Ergebnisse erfolgte eine Clusteranalyse in Form einer Einteilung in 6 Biotypen, die je nach Typ Aufschluss darüber geben sollte, welche Therapieform mehr oder minder Erfolg haben könnte. Die Teilnehmenden wurden dafür randomisiert und erhielten entweder eines der 3 am häufigsten verschriebenen Antidepressiva Escitalopram, Sertralin oder Venlafaxin (mit verlängerter Freisetzung) (n=164) oder eine Verhaltenstherapie (n=86).1
Biotypen zeigen unterschiedliches Therapieansprechen
Unter Einbezug der MRT, komplexer statistischer Analysen und weiterer klinischer Messwerte konnten die Forschenden folgende Schlussfolgerungen ziehen: Das Ansprechen auf eine antidepressive Therapie scheint von der Gehirnaktivität abhängig zu sein. So konnte u. a. gezeigt werden:1
- Eine Hyperaktivität in kognitiven Hirnregionen ging mit einem guten Ansprechen auf Venlafaxin einher.
- Erkrankte mit geringerer Gehirnaktivität in den für die Aufmerksamkeit zuständigen Hirnregionen sprachen weniger stark auf eine Verhaltenstherapie an. Die Autorschaft rät bei diesem Biotyp zur medikamentösen Therapie.
Biotypenclustering: Zukunftsmusik oder Zauberei?
So klar die Ergebnisse in der Studie sind – die Zuordnung in Biotypen scheint in der Praxis pure Utopie zu sein. Die Forschenden widmen sich nun der Frage: Wie kann die Heterogenität von Depression und Angststörung in diesem Ansatz auf der individuellen Patientenebene differenzierter betrachtet werden?
Demnach bleibt im Praxisalltag nur die Option, die antidepressive Therapie gemäß den Empfehlungen der Nationalen VersorgungsLeitlinie zur Unipolaren Depression auszuwählen.
Auswahl des Antidepressivums: Was sagt die Leitlinie?
Die Auswahl des Antidepressivums kann nach Symptomschwere zusammen mit dem Erkrankten wie folgt erwogen werden:3
- antriebssteigerndes Antidepressivum: z. B. SSRI wie Citalopram, Fluoxetin, Sertralin, u. a. bei antriebslosen Patientinnen oder Patienten
- sedierendes Antidepressivum: bei hohem Leidensdruck wegen Schlaflosigkeit, wie z. B. Mirtazapin, Amitriptylin oder Clomipramin.
- pflanzliches Antidepressivum: z. B. hochdosierter Johanniskraut-Extrakt (Laif®900) bei Patientinnen und Patienten, die chemische Antidepressiva von sich aus ablehnen oder Angst vor deren Nebenwirkungen haben.
Nichtansprechen – Das rät die Leitlinie
Um ein Nichtansprechen früh erkennen zu können, empfiehlt die Versorgungleitlinie bereits zu Beginn einer medikamentösen Behandlung zu vereinbaren, zu welchem Zeitpunkt das Ansprechen bewertet und ggf. über ein anderes Vorgehen entschieden wird (CAVE: Wirklatenz bei Antidepressiva beachten).3
Zeigt sich nach 4 Wochen kein Ansprechen auf die Antidepressivum-Monotherapie, sollen Ursachen evaluiert werden:3
- Fehldiagnose einer depressiven Störung,
- mangelnde Adhärenz der Patienten
- nicht angemessene Dosis und zu niedriger Serumspiegel und
- somatische und psychische Komorbidität sowie eine depressiogene Komedikation.
Augmentation, Kombinationstherapie oder Switch als weitere Maßnahmen
Mögliche Behandlungsoptionen bei Nicht-Ansprechen sind laut Leitlinie:3
- Serumspiegel anpassen: Liegt er außerhalb des therapeutischen Bereichs, soll korrigiert werden.
- Augmentation mit verschiedenen Wirkstoffen: Bei Nicht-Ansprechen auf eine Antidepressivum-Monotherapie kann eine Augmentation mit Quetiapin (zugelassen), Aripiprazol, Olanzapin oder Risperidon (jeweils off-label) in niedrigen Dosierungen angeboten werden oder mit Lithium.
- Kombination mit 2. Antidepressivum: Bei Nicht-Ansprechen der Monotherapie ist alternativ eine Kombination von SSRI, SNRI oder TZA mit Mianserin sowie Mirtazapin oder Trazodon möglich.
- Switch auf ein anderes Antidepressivum: Ein einmaliger Wechsel auf ein Antidepressivum mit anderem Wirkmechanismus kann sinnvoll sein. Achtung: Schrittweise Aufdosierung des neuen und ausschleichendes Absetzen des alten Antidepressivums.
- Kombination mit Psychotherapie: Es besteht die Option, Betroffenen zusätzlich eine Psychotherapie anzubieten.
Die VersorgungsLeitlinie empfiehlt vor Abänderung der Therapie zunächst die behebbaren Ursachen eines Nichtansprechens zu erörtern. In der Praxis lässt sich auf diese Weise bereits häufig die Therapie korrigieren. Dies erspart sowohl Kosten als auch unnötige Nebenwirkungen einer verstärkten Therapie.2 Mehr zum Thema finden Sie in der VersorgungsLeitlinie zur Unipolaren Depression.
Quellen:
- Tozzi L et al. Personalized brain circuit scores identify clinically distinct biotypes in depression and anxiety. Nature Medicine 2024(30):2076–2087.
- Nationale VersorgungsLeitlinie Unipolare Depression, Langfassung, Version 3.0, 2022, AWMF-Register-Nr. nvl-005.
- Gehrisch J et al. Leitliniengerechte Pharmakotherapie der Depression. Arzneiverordnung in der Praxis, Ausgabe 3, Juli 2018.
Bildquelle: https://www.gettyimages.de/detail/foto/teenagers-standing-in-line-in-informal-poses-looking-lizenzfreies-bild/dv168123b, Symbolbild mit Modellen
Weitere Beiträge
Sie benötigen medizinische Informationen zu diesem Produkt?
Wir sind für Sie da:
Mo-Fr: 8:00 - 18:00 Uhr
Tel.: 0800 6422937
E-mail: medical-information@bayer.com
Web: www.medinfo.bayer.de
Haben Sie Fragen rund um das vielfältige Service-Angebot von Bayer Vital?
Dann schreiben Sie uns einfach über unser Kontakformular.
Wir freuen uns auf Ihre Anmerkungen.